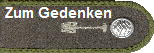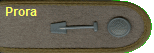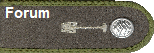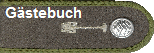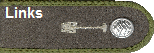Hendrik Liersch (ehemaliger Bausoldat) (E-Mailadresse Nr. 02)
Der Gewalt ausgesetzt, auch ohne Krieg
Zur Musterung bekam ich eine Karte vom Wehrkreiskommando zugeschickt, nachdem in den Zeitungen und auf Plakaten an den Litfaßsäulen darüber informiert wurde, daß der Jahrgang 1962 nun an der Reihe ist. Auch der Hinweis fehlte nicht, daß, wenn man keine Karte bekommt, man sich selbst melden soll und muß. Nun gut, ich war gerade krankgeschrieben, aber nicht bettlägerig und hatte auf Musterung gar keine Lust. Also schrieb ich wiederum eine Karte zurück, daß ich nicht kommen könnte. Im nächsten Jahr, also 1981 erhielt ich wieder eine Einladung zur Musterung, allerdings mit dem dezenten Hinweis, wenn ich nicht erscheine, oder ein ärztliches Attest vorweisen kann, kommt die Deutsche Volkspolizei und bringt mich auf meine Kosten zur Musterungskommission. Eine sogenannte Zuführung. Das dann doch nicht.
Nachdem die ausgiebige ärztliche Untersuchung, mit dem zurückziehen der Vorhaut und deren Begutachtung durch eine Ärztin und ähnlichem, nur mit Strümpfen bekleidet erfolgt war, kam ein Herr in Zivil auf mich zu. Dieser wollte unbedingt schon vor dem Gespräch mit der
Musterungskommission mit mir sprechen und bat mich in ein kleines Zimmer. Ich ließ jenen Mann nicht zu Wort kommen und erzählte ihm ausgiebig von meinem Wunsch Bausoldat zu werden und keine Waffe in die Hand zu nehmen. „Nun gut, Sie werden dann aufgerufen“, so seine Worte.
Die mit mir am Morgen gemeinsam gekommenen jungen Männer verließen nach und nach das Wehrkreiskommando. Allein im Flur sitzend, vergingen mehrere Stunden ereignislos. Dann wurde ich als letzter hier noch verbliebener Musterungskandidat in einen Saal gebeten, dort saßen 5 Männer in Uniform und der mir schon bekannte Herr in Zivil. Nochmals hielt ich meinen Vortrag, auf den ich mich ja ausgiebig vorbereitet hatte. Dieser muß trotz meiner inneren Aufregung so überzeugend gewesen sein, daß nur eine Gegenfrage gestellt wurde. Dann mußte ich in einem Nebenraum meine Absicht schriftlich fixieren und unterschreiben. Wenig später bekam ich vor der Kommission der 6 Herren meine Erkennungsmarke aus Aluminium und meinen Wehrdienstausweis und hatte die Gewißheit, daß mir von nun an viele Türen verschlossen bleiben würden in diesem Land.
Die Entscheidung zu den Bausoldaten zu gehen, hatte ich in der Lehrzeit nach einem GST-Lager am Glubigsee getroffen, als wir auf dem Schießplatz in Berlin-Hirschgarten mit Maschinengewehren schießen sollten, 2 Mitlehrlinge verweigerten dies, damals habe ich selbst noch geschossen. Dort erfuhr ich zum ersten Mal von der Möglichkeit den Dienst mit der Waffe zu verweigern. Das war mein fauler Kompromiß, denn vor der Totalverweigerung schreckte mich der Knast ab, denn ich wollte als menschlich einigermaßen intaktes Wesen weiterleben nach der Armee und sah darin mehr Chancen, wenn ich nur den Waffendienst verweigerte. Nach der Musterung vergingen etliche Jahre meines Lebens unbehelligt von der Armee.
Normale Soldaten, welche sich nicht mit uns unterhalten durften, wurden so früh als möglich einberufen, um die Chance zu haben, diese in jungen Jahren noch dem Staat entsprechend zu beeinflussen und „richtige“ Männer aus ihnen zu machen. Dahingegen wurden die Bausoldaten, bei denen ja sowieso Hopfen und Malz verloren war, welche also eine eigene Meinung hatten, so spät als möglich einberufen, wobei Wohnort und Einsatzort bei der Armee möglichst weit auseinander lagen, im Rahmen der kleinen DDR. In Prora auf Rügen fanden sich später keine Norddeutschen, nur wenige Berliner und sehr viele Sachsen und Thüringer. Damit war dem Staat wenigstens die Möglichkeit gegeben uns aus dem Leben herauszureißen, weg von der eigenen Familie oder aus beruflichen Entwicklungen. So bekam ich ein halbes Jahr nach meiner Heirat die Aufforderung zur Einberufungsüberprüfung zum 3. März 1987 und erinnerte mich nun daran, 1983 eine Hälfte meiner Erkennungsmarke einem Freund geschenkt zu haben, welcher mittlerweile im anderen Teil Deutschlands lebte. (Ich habe die gesamte Armeezeit dann mit nur einer halben Erkennungsmarke unentdeckt überstanden.) Da andere Freunde jedes Jahr zur
Einberufungsüberprüfung mußten, machte ich mir noch keine konkreten Sorgen. Um Ostern, also Anfang April, kurz vor meinem Geburtstag bekam ich eine Postkarte, daß ich mich in vier Wochen in Prora zum Wehrdienst einzufinden habe und welche Sachen ich dazu mitbringen muß. Mit Hilfe einer
DDR-Landkarte suchte ich erst einmal Prora und fand es zwischen Saßnitz und Binz auf der Insel Rügen. Ich erinnerte mich daran, daß mein Vater als ABF-Student nach dem Krieg dort mit seinen Kommilitonen in den KDF-Ruinen im Sommerurlaub kampiert hatte. An das in der Nähe befindliche Naturschutzgebiet mit den Feuersteinfeldern konnte ich mich noch aus Kindertagen erinnern. Mit dem Wissen 14 Tage Grundausbildung zu haben und dann irgendwo auf einer Baustelle zu arbeiten und selten zu Hause zu sein in den nächsten 18 Monaten setzte ich mich in den Zug und fuhr sechs Stunden von Berlin nach Prora.
Die Kaserne in Prora liegt direkt an der Ostsee, basierend auf den nicht fertiggebauten und zum Teil nach dem Krieg gesprengten KDF-Bauten zieht sich die gesamte Anlage über mehrere Kilometer an der Küste entlang. 5 Etagen. Von der NVA in vier separate Abschnitte unterteilt. Angefangen mit einem nach 1945 gesprengten und nicht wieder aufgebauten Teil voller Betonruinen, dann unserer Teil mit den knapp 500 Bausoldaten und einem Fuhr- und Technikpark. Dann ein Teil, welcher der Ausbildung von Offizieren diente. Dort wurden auch aus der mit der DDR befreundeten Länder, bis nach Afrika hin, junge Männer ausgebildet, welche in Zivil in den Ausgang nach Binz durften, da eine Gruppe Farbiger in NVA-Uniform wohl nicht in das offizielle Sommer-Urlaubsbild der FDGB-Urlauber paßte. Den vierten Teil bildete das Erholungsheim „Walter Ulbricht“ – ausschließlich für militärische Urlauber, also Offiziere gedacht. Zur Legendenbildung trugen unsere Offiziere selbst fleißig bei, diese erzählten in Argentinien gebe es eine baugleiche Kaserne, des weiteren wurde von U-Boothäfen, einer U-Bahn und fünf durch Wasser unzugänglichen Kellergeschossen (kein Taucher kam dort jemals wieder lebend raus!) erzählt. Diese Erzählungen und ihre vorne hochgebogenen Mützen, sowie detailreiche Kenntnisse der Waffen des 2. Weltkrieges erweckten in mir den Eindruck, daß diese unsere Offiziere, welche zum großen Teil strafversetzt zu uns waren, mindestens 50 Jahre zu spät geboren waren.
Dieser Eindruck verstärkte sich nach einer ersten Begutachtung unseres Zimmers kurz nach der Grundausbildung durch einen mir fremden Offizier aus dem Stab mit roten Streifen an der Hose. Pro ca. 20 Quadratmeter großem Zimmer für 6 Bausoldaten mit 3 eisernen Doppelstockbetten, einem Tisch und sechs Hockern als Inventar waren als Kür bis zu drei Topfpflanzen und ein gerahmtes Bild an der unverputzten geweißten Betonwand erlaubt. Unser Bild war ein farbiges Fotoplakat, auf dem in einer versifften Studentenbude ein völlig unbekleideter farbiger junger Mann auf dem Tisch sitzt.
Wir mußten zu dieser Begehung vor den Zimmern auf dem Flur antreten, durch die offene Tür hörten wir den Offizier sagen: „Der Nigger kommt ab!“ Eine untere Charge kam mit unserem Bild unterm Arm aus unserem Zimmer und verschwand mit diesem. Nach einer schriftlichen Beschwerde auf dem Dienstweg, wegen Rassismus, wurde das Bild uns wieder ausgehändigt um einige Wochen später erneut konfisziert zu werden, diesmal allerdings wegen Pornographie. Unser zweites Bild hat die restlichen 17 Monate unbeschadet überstanden, weil unsere Offiziere keinen haltbaren Grund fanden es zu entfernen. Darauf zu sehen: Etliche Tiere sitzen auf einer Parkbank und schauen auf eine Kinoleinwand. Ein Maulwurf mit einem goldenen Spaten in der Hand (mit nach oben gestrecktem Arm) kommt aus einem Maulwurfshügel. Auf der Rückseite der Parkbank steht: „Das ganze Jahr ist Kinozeit!“
Diese für uns Bausoldaten lebensfeindliche Atmosphäre, mein Freund und Zimmermitbewohner Sebastian Höfer, Orgelbauer aus Dresden hat die Bausoldatenzeit leider nicht lebend überstanden, setzte sich in allen Lebensbereichen fort. Um nach der monatlich stattfindenden Aus-zahlung des Solds mit dem Spruch: „Genosse Oberfeldwebel, Bausoldat Liersch bereit zum Empfang der Dienstbezüge!“ - 150 Mark in bar – dieses Geld auch gleich wieder auszugeben für mehr oder weniger sinnvolle oder nützliche Dinge und trotzdem nicht die Kaserne verlassen zu müssen gab es dort eine MHO (Militärische Handelsorganisation). Dort konnte man Nachmittags, falls nicht auf der Baustelle, einkaufen – denn vormittags wenn es zweimal im Jahr Bananen, Melonen etc. gab, durften nur Offiziere einkaufen. Und so sah man wenigstens aus nächster Nähe Vitamine in Einkaufsnetzen, welche nach dem Mittag natürlich ausverkauft waren.
Musikinstrumente durften ausschließlich in den Toilettenräumen gespielt werden. Kollektives Massenduschen in saalartigen 70-Mann-Duschen, ein Mal pro Woche, weckte böse
Erinnerungen – in der Jugendherberge auf dem Ettersberg zu schlafen, hatte ich mich als Jugendlicher geweigert. Dort wohnten früher die SS-Schergen. So war für mich auch der Aufenthalt in diesem Nazibauwerk rund um die Uhr, 18 Monate lang, eine Belastung. Die Ähnlichkeit der NVA-Uniform zur Wehrmachtsuniform habe ich in einem Selbstversuch
nachgestellt. Ich in NVA-Uniform mit einem mit grüner Bootslackfarbe auf den Rost gestrichenem Stahlhelm der Nazis als Kopfbedeckung vor dem heimischen Spiegel, staunend über die Ähnlichkeit.
Nicht nur in den Dienstzimmern der Offiziere, dort waren in den Schränken, an den Wänden und auf den Tischen diverse Untersetzer, Wimpel, Plaketten, Bilder und die ganze Bandbreite der zu politischem Kitsch verarbeiteten Ideologie, wie sie solche Staaten massenhaft produzieren – auch im Gelände der Kaserne waren bunte Werbetafeln mit martialischen Soldaten, darunter der Spruch: „Die DDR bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen!“
Es gab auch einen Ehrenhain, in dem sich einmal ein Offizier beim Rückweg aus unserem Ausgang ausgiebig auspinkelte. Unser Feldwebel war nach der Feier für einen neuen Stern auf seinem Schulterstück so betrunken, daß er in eine Baugrube der Baustelle stürzte und so zeterte, daß ihm der neue Stern wieder aberkannt wurde und er Kasernenarrest über mehrere Wochen hatte. Unser Kompaniechef stotterte wenn er aufgeregt war und ließ sich vom Förster beim klauen eines Weihnachtsbaumes im Wald, der sowieso der Armee gehörte, erwischen.
Insgesamt ergab sich für mich der Eindruck von unseren stolzen deutschen Volksoffizieren wie folgt: oft alkoholabhängig und meist begrenzt der deutschen Sprache in Schrift- und Sprachform mächtig. Einer unserer Vorgesetzten war Teilfacharbeiter Fluchtenmaurer mit dem Abschluß 8. Klasse. Wenn also eine Ecke, ein Fenster oder eine Tür kam, mußte er einen richtigen Maurer holen. Das bestärkte meine ständige Angst und ein Gefühl des Ausgeliefertseins, gerade Macht gepaart mit Dummheit ist gefährlich beim Katz und Maus spielen, wenn man selber die Maus ist.
Da wie ich selber auch die Offiziere nicht wußten, daß der Rechtsanwalt Schnur ein Spitzel war, zeitigte sein Brief an mich mit dem Hilfsangebot, er würde mich bei weiteren Problemen besuchen einige Wirkung. Sein Brief brauchte merkwürdig lange und war perfekt wieder zugeklebt. Als Ergebnis hatte ich eine Privataudienz beim obersten Chef von Prora, der auf altväterlich machend zu mir sagte: „Bausoldat Liersch, wie kann ich Ihnen helfen?“
In meinen Stasiakten findet sich nichts über meine Bausoldatenzeit. Leider. Diese Armeeakten wurden auf Anweisung des letzten Verteidigungsministers der DDR von Strausberg in die Mollstraße gebracht und dort vernichtet, so die Auskunft bei der Einsicht in meine Stasiopfterakte.
Anmerkung: Mit Einführung der Wehrpflicht in der DDR im Januar 1962, gab es keine Möglichkeit für einen zivilen Ersatzdienst. Verweigerer erhielten mehrjährige Haftstrafen. Ein für den Warschauer Pakt einmaliger Kompromiss wurde im Herbst 1964 zugelassen: die Baueinheiten in der NVA. Seit 1964 dienten ca. 15tausend Bausoldaten ohne Waffe in der DDR-Armee. Statt eines Fahneneides sprachen sie nur ein Gelöbnis und wurden nicht befördert. Auf den Schulterstücken hatten sie einen Spaten. Vor und nach ihrer Armeezeit war ihnen der Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen nahezu unmöglich, sie wurden diskriminiert und oft von der Staatssicherheit überwacht.
Alle Rechte bei: Hendrik Liersch

Startseite; Zum Gedenken; Presseseite; Prora; Fragen; Bausoldaten; Vorgesetzte; Literatur; Gästebuch; Kontakte; Termine; Links

_______________________________________________________________________________________________